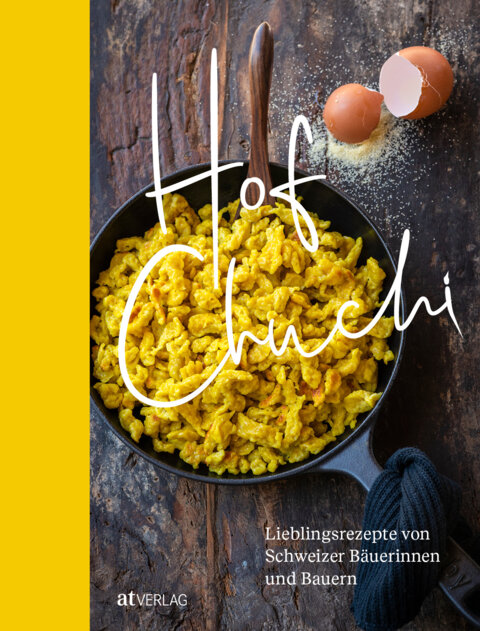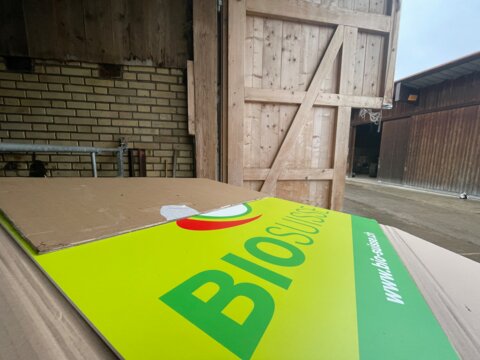Seit dem 1. Januar 2024 sind die Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz verpflichtet, Gülleaustragsysteme einzusetzen, welche die Ammoniakverluste reduzieren. Diese Auflage führte dazu, dass viele Landwirte eine Anpassung ihrer Güllefässer oder gar den Kauf einer neuen Maschine mit Schleppschlauch ins Auge fassen. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gerätetypen werden in der Tabelle beschrieben.
Ein einfaches System
Der Hersteller Mai Maschinen AG hat einen Schleppschlauchverteiler-Eigenbau im Angebot, bestehend aus zwei Pendelarmen, die quer zur Fahrrichtung hin- und hergeschwenkt werden. Jeder Arm endet in zwei Ausgängen, die mit je einem sehr flexiblen Schlauch versehen sind. Durch die Einstellung der Pendelgeschwindigkeit über einen Hydraulikmotor und der Fahrgeschwindigkeit wird das Streubild stufenlos angepasst. Die Benutzerfreundlichkeit des Systems, geringe Anschaffungskosten und ein niedriges Eigengewicht, das die Gewichtsverteilung bei einem Fassanbau nur unwesentlich verändert, zählen zu den Vorteilen dieser Ausstattung. Zudem funktioniert das System ohne Schneidkopf, wodurch sich der Verschleiss verringert. Eine Gummidüse in jedem Pendelarm sorgt dafür, den Systemdruck aufrechtzuhalten. Bei der Variante für den Dreipunkt-Anbau wird der Schleppschlauch hydraulisch oder über die Zapfwelle angetrieben.
Unser Tipp
Wie soll Gülle ausgebracht werden?
– mit einem System, das die Emissionen reduziert
– bei optimalem, bewölktem Wetter
– regelmässig und ohne das Futter zu verschmutzen
– mengenmässig auf den Bedarf der Wiese, Weide oder angebauten Kultur abgestimmt
– auf einen abgetrockneten, durchlässigen Boden.
Ein Verteiler ohne Ablaufschläuche
Das Gülleausbringsystem Schleppfix des Schweizer Herstellers Swisstec AG setzt sich aus rostfreien Verteilkästen zusammen, die mit einem patentierten Kunststoff-Verteilteller ausgestattet sind. Da auf einen Verteilerkopf mit rotierenden Elementen verzichtet wird, verringern sich Verschleiss und Wartungskosten. Dank austauschbarer Düse kann die Ausbringmenge problemlos angepasst werden. Die unter den Verteilkästen montierten Ablaufschuhe führen die Gülle ohne Ablaufschlauch direkt in den Boden. Standardmässig weisen die Schleppschuhe einen Abstand von 30 cm auf, optional ist jedoch ein Doppelschuh mit 15 cm Abstand aus verschleissfestem Kunststoff erhältlich. Auch in Hanglagen wird die Gülle gleichmässig über die gesamte Breite verteilt.
Schleppschlauchverteiler
Beim Schleppschuh wird die Gülle über die Schläuche zum Schuh geführt und dringt in schmalen Streifen direkt in den Boden. Die Flexibilität der Vorrichtung ermöglicht eine permanente Anpassung an das Gelände. Da die Schleppschuhe die Gülle in den Boden ablegen, bleibt das Futter sauber. Das System funktioniert üblicherweise mit einem Schneidverteiler, der für eine gleichmässige Verteilung der Gülle zu jedem Auslauf sorgt. Der Hauptvorteil besteht in der präzisen Anwendung und den geringen Ammoniakverlusten.
Jedes Schleppschlauchsystem ermöglicht eine Reduzierung der Ammoniakemissionen.
Das Prinzip der Gülleverteilung mit einem Schleppschlauch ohne Schleppschuh funktioniert weitgehend gleich und ermöglicht ebenfalls eine gute Gülleverteilung. Jedoch besteht ohne Schleppschuhe ein erhöhtes Risiko für Futterverschmutzung. Die grössten Modelle weisen eine Ausbringbreite von bis zu 30 Meter auf, allerdings bei einem geringeren Gewicht des Gestänges.
Vorschriften und Auflagen
Indem die verschiedenen Systeme zum Ausbringen der Gülle die Ammoniakemissionen senken, tragen sie gleichzeitig auch mehr Stickstoff in den Boden ein. Deshalb ist es zur Berechnung der Düngerbilanz künftig unerlässlich, bei zwei oder mehr Ausbringungen pro Jahr sechs Einheiten Stickstoff pro Hektar hinzuzufügen, die mit diesem System ausgebracht wurden. Wird im Feldkalender nachgewiesen, dass die Fläche nur einmal gedüngt wurde, können drei Einheiten Stickstoff pro gedüngte Hektare hinzugezählt werden.
Schleppschlauch-Obligatorium
Nicht unter das Schleppschlauch-Obligatorium fallen: Flächen von weniger als 25 Aren; Flächen, die mit einem emissionsmindernden System nicht zugänglich sind (Weg, Obstanlage), wobei ein Bewilligungsgesuch beim Kanton einzureichen ist. Ebenfalls vom Obligatorium ausgenommen sind automatisch Parzellen mit grosser Hangneigung, die jeweils satellitengestützt berechnet wird.