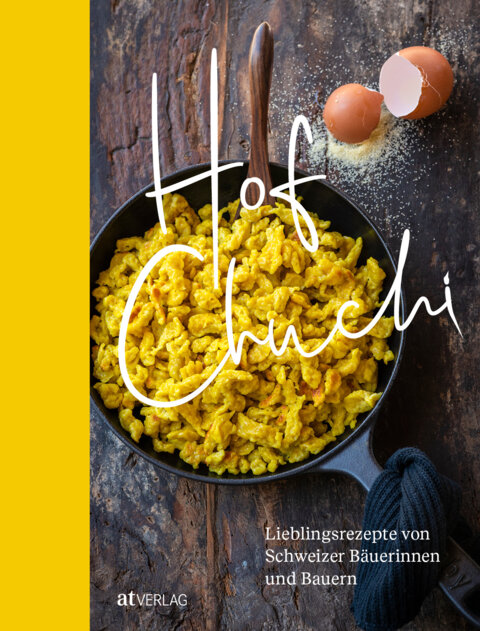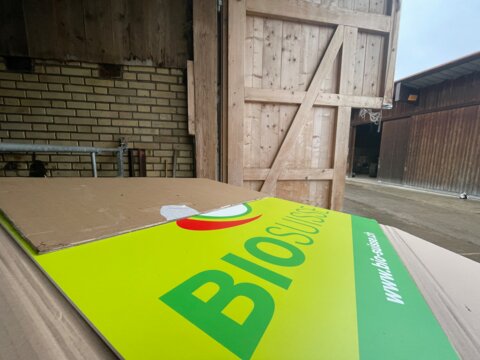Verletzungen an Schwänzen von Schweinen können durch primäres Beissen (Verhaltensprobleme, Überforderung, Aggression) oder sekundäres Beissen (Tolerieren des Gebissenwerdens) aufgrund von Gewebsnekrosen (z. B. bei SINS) entstehen. Schwanznekrosen starten meist als lokale Entzündung an der Schwanzbasis von wenigen Tagen alten Ferkeln. Bei leichten Fällen kann das Problem erst im Maststall auffallen.
Wie erkenne ich SINS im Stall?
Bei den Saugferkeln sollen bereits in den ersten Lebenstagen die Schwänze genau untersucht werden. Als erste Stufe der Veränderung sieht man einen Borstenausfall und eine Schwellung, dazu kommt eine Rötung, es gibt Ausschwitzungen und Auflagerungen. Später sieht man das abgestorbene Gewebe der Schwanznekrose. Der Schwanz kann nach zwei Wochen abfallen. Es sieht aus, wie wenn das Ferkel kupiert wurde oder die Muttersau auf die Schwänze gestanden wäre. An der Ohrbasis kann es zu ähnlichen Hautveränderungen kommen. Bei den Klauen zeigen sich Entzündungen und Nekrosen als Schwellung am Kronsaum, Einblutungen oder Ablösungen von Sohle und Ballen bereits in den ersten Lebenstagen oder sogar schon bei der Geburt.
Wie entstehen die Veränderungen?
Als Krankheitsursache wird eine Überbelastung von Darm und Leber der Muttersau angenommen, welche sich bei den Ferkeln auf die kleinen Blutgefässe in Schwanz, Ohren oder Klauen niederschlägt. Dort zeigt sich erst eine Schwellung aufgrund der gesteigerten Durchblutung und erhöhten Durchlässigkeit des Gewebes (Ödem). Schliesslich kommt es durch eine Gerinnung zum Verschluss von Blutgefässen und zum Absterben des Gewebes (Nekrose) aufgrund der mangelnden Sauerstoff- und Nährstoffversorgung. Auslöser können Mykotoxine (z. B. Deoxynivalenol DON) sein, die zu Entzündungen in Darm und Leber führen. Oder es kommt zu einer Ansammlung und Ausbreitung von Abbauprodukten aus Darmbakterien (Lipopolysaccharide LPS bzw. Endotoxine), die normalerweise kontinuierlich durch die Galle und Leber inaktiviert werden. Risikofaktoren hierfür sind unter anderem Darmerkrankungen (z. B. Leaky-Gut-Syndrom), eine eiweiss- und stärkereiche Fütterung mit wenig Rohfaser, Wassermangel oder Hitzestress.
Wie kann ich SINS vorbeugen?
Die Bereiche Fütterung, Wasserversorgung, Stress und Thermoregulation (Abkühlungsmöglichkeiten gegen Hitzestress) sollten im Bestand optimiert werden. Es macht Sinn, die Darmstabilität mittels Mykotoxinbinder, Rohfasern und Gesteinserde zu stärken. Eine ausgezeichnete Wasserversorgung mit einer Wasserhygienisierung (meist auf Chlorbasis) und einem Wasserzähler stellt die nötige Versorgung sicher.
Bei Hitze fehlt das Blut, welches für die Thermoregulation in die Haut gepumpt wird, anschliessend im Darm. Der Darm der Muttersau wird durchlässig für Giftstoffe, welche in den Körper abschwemmen. Diese können bereits während der Trächtigkeit beginnen, bei den Ferkeln in den Schwänzen, Klauen und an den Ohren Veränderungen hervorzurufen.