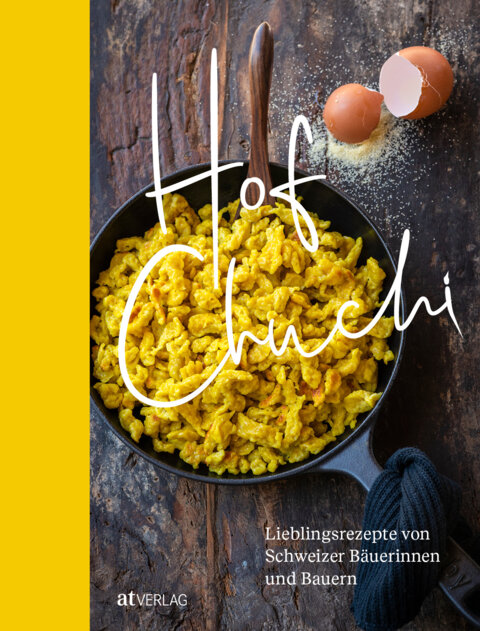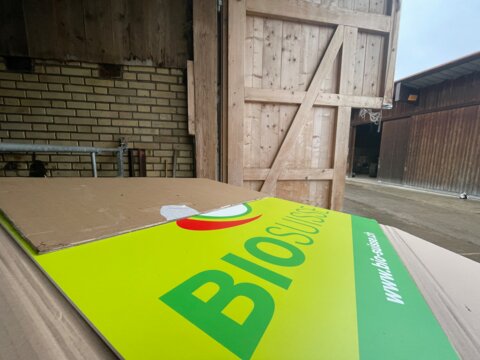Durch den Strukturwandel und den Rückgang der Landwirtschaftsbetriebe nimmt der Anteil der gepachteten Flächen stetig zu. Während im Jahr 1965 noch 33 % der Nutzfläche verpachtet waren, sind es heute knapp 50 %. Tendenz steigend. In absehbarer Zeit wird mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr im Eigentum von aktiven Landwirten sein, sondern von Privatpersonen oder der öffentlichen Hand verpachtet werden.
Mit dem steigenden Pachtlandanteil nehmen in der Beratungspraxis auch Anfragen im Bereich des Pachtrechts zu. Die Fragen über die Rechte und Pflichten von Pächterinnen und Pächtern und die teilweise damit verbundenen Konflikte mit Verpachtenden häufen sich. Ebenso zeigt sich, dass der Kampf um Pachtland unter den Landwirtschaftsbetrieben immer härter wird. Nicht selten wird bei Verpächtern aktiv um Pachtland geworben. Entsprechend häufig kommt es zu Kündigungen von Pachtflächen. Dies wiederum führt zu einer Häufung von Anfragen von Pächterinnen und Pächstern, die sich nach dem richtigen Vorgehen einer Pachterstreckung erkundigen. Nachfolgend eine Auswahl von Fragestellungen, die in der Praxis häufig auftauchen.
Teilzahlung
«Der Vertragsentwurf meines Verpächters beinhaltet quartalsweise Teilzahlungen des Pacht zinses. Ist dies rechtlich zulässig?»
Das Obligationenrecht (OR) sieht vor, dass der Pachtzins jeweils am Ende eines Pachtjahres bezahlt wird. Diese Lösung, die auch bei landwirtschaftlichen Pachten zur Anwendung kommt, hat ihre Berechtigung. Nach dem Ende des Pachtjahres ist die Ernte eingefahren und der Zins kann aus dem Ertrag des Verkaufes der Tier- und Ackerprodukte bezahlt werden. Das Gesetz lässt aber die Vereinbarung eines anderen Zahlungstermins zu. Gerade bei hohen Pachtzinsen von Gewerben bieten sich Teilzahlungen (z. B. quartalsweise oder halbjährlich) an. Der 30. Juni ist als Zahlungstermin insofern geeignet, weil zu diesem Zeitpunkt jeweils der erste Teil der Direktzahlungen ausgerichtet wird und die Pächterin oder der Pächter dann üblicherweise über Mittel verfügt, um die Hälfte des Pachtzinses zu bezahlen. Es empfiehlt sich, schriftliche Pachtverträge abzuschliessen und darin die Zahlungstermine im Detail festzulegen.
Vertragsform
«Ich bewirtschafte seit einigen Jahren die zwei Hektaren grosse Nachbarparzelle, habe aber keinen schriftlichen Pachtvertrag. Besteht trotzdem ein gültiges Pachtverhältnis?»
Ein Pachtvertrag entsteht gemäss dem Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG), indem der Verpächter dem Pächter ein Grundstück oder ein Gewerbe gegen Entgelt zur landwirtschaftlichen Nutzung überlässt. Weder das LPG noch das Obligationenrecht (OR) sehen für den Pachtvertrag bestimmte Formvorschriften vor. Ein Pachtvertrag kann folglich nicht nur durch Schriftlichkeit, sondern auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten geschlossen werden. Ein solches Verhalten kann darin liegen, dass die Pächterin das Grundstück ungehindert bewirtschaftet und die Verpächterin dafür ein Entgelt entgegennimmt. Mündliche Pachtverträge haben folglich entgegen der landläufigen Meinung die gleiche Rechtswirkung wie schriftliche Verträge, sofern deren Zustandekommen bewiesen werden kann. Es ist ratsam, Belege über Pachtzinszahlungen (Quittungen, Bankbelege) sorgfältig aufzubewahren, solange das Pachtverhältnis andauert.
Geländeveränderung
«Darf ich als Pächter auf dem Pachtland eine Hecke pflanzen?»
Strukturelemente wie Hecken können wegen zusätzlicher Direktzahlungen für den Pächter von Interesse sein. Allerdings darf ein Pächter ohne schriftliche Einwilligung des Verpächters keine Änderungen am Pachtgegenstand vornehmen, die über das Pachtende hinaus von wesentlicher Bedeutung sind. Während ein Asthaufen ohne grossen Aufwand wieder entfernt werden kann, ist dies bei einer Hecke nicht einfach so möglich. Folglich sollte die Zustimmung der Verpächterin zur Pflanzung einer Hecke im Pachtvertrag schriftlich festgehalten werden. Ebenso ist zu regeln, ob die Hecke bei Pachtende beseitigt werden muss bzw. überhaupt noch entfernt werden darf oder auf dem Pachtland verbleibt. Ein Entfernen ist beispielsweise bei vertraglich gebundenen Vernetzungsprojekten oft gar nicht mehr möglich.
Pachterstreckung
«Mein Verpächter hat mir das Pachtverhältnis gekündigt, weil er das Land ‹pachtfrei› veräussern möchte. Wie muss ich vor gehen, wenn ich eine Pacht erstreckung erwirken möchte?»
Begehren auf Pachterstreckung sind bei den Schlichtungsstellen am Ort des Pachtgegenstandes geltend zu machen. Als Schlichtungsstelle fungieren vielerorts die örtlichen Friedensrichterinnen und -richter oder die kantonalen Schlichtungsstellen für Pacht und Miete. Es empfiehlt sich, vorab sorgfältig zu klären, wer im konkreten Fall für die Behandlung des Erstreckungsbegehrens zuständig ist. Die Anforderungen an das Schlichtungsgesuch selbst sind gering. Das Gesuch, das innert drei Monaten seit Erhalt der Kündigung gestellt werden muss, kann theoretisch gar mündlich bei der Schlichtungsstelle zu Protokoll gegeben werden. Je nach Härte der Kündigungsauswirkungen für die Pächterin, wenn etwa ein wesentlicher Teil der Betriebsfläche oder gar ein ganzes landwirtschaftliches Gewerbe gekündigt wird, lohnt sich der Beizug einer Fachperson und die Ausarbeitung eines begründeten Schlichtungsgesuchs sehr. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos, mündlich und in weiten Teilen formlos. Ziel des Schlichtungsverfahrens ist es, die Parteien zu versöhnen. Ist keine Einigung möglich, erteilt die Schlichtungsstelle der Pächterin die Klagebewilligung, die zur Einreichung der Klage beim erstinstanzlichen Zivilgericht berechtigt. Gerichtsverfahren gestalten sich ungleich formeller und aufwendiger als Schlichtungsverfahren. Folglich empfiehlt sich spätestens nach Erhalt der Klagebewilligung der Beizug eines juristischen Beraters.
Folgende Punkte sollte ein Pachtvertrag für Grundstücke regeln
- Definition Pachtgegenstand, Art der Bodennutzung bei Pachtantritt
- Pachtbeginn und -dauer
- Kündigungsfrist
- Pachtzins
- Allfällige Bewirtschaftungsauflagen
- Obstbäume inbegriffen oder nicht
- Umfang Unterhaltspflicht Pächterin bzw. Pächter
- Unterpacht
- Allfällige Versicherungspflichten Pächter (bspw. Hagelversicherung)
- Vorgehen bei Streitigkeiten / allfällige Mediationsklausel
Musterpachtvertrag: www.agriexpert.ch ➞ Shop ➞ Pachtrecht