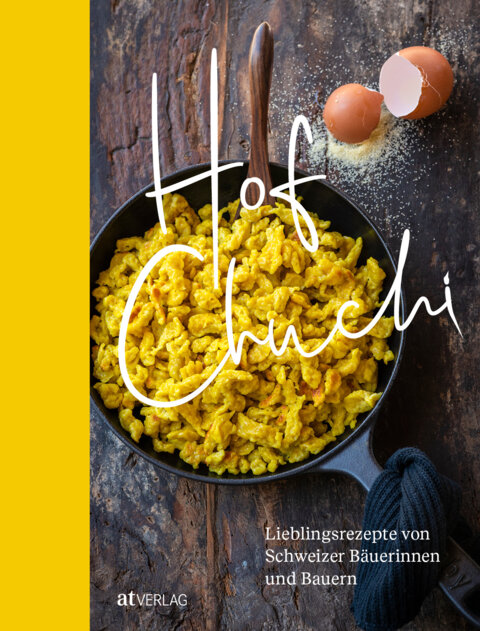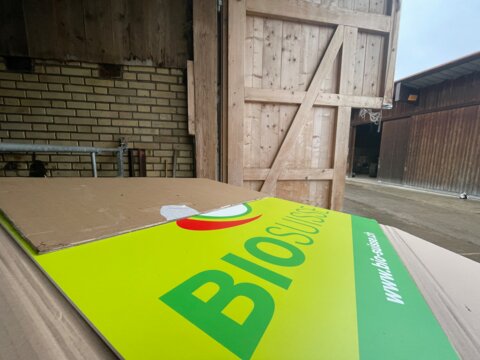Quer gelesen
- Der Immunstatus einer Kuh spielt eine wesentliche Rolle, wie schwer einzelne Tiere an einer Infektion erkranken.
- In Phasen wie Hitzestress ist die Gefahr von starker Vermehrung gewisser Erreger erhöht.
- Stallhygienische Aspekte spielen in der Verhinderung von Infektionen eine bedeutende Rolle.
Euterentzündungen sind Entzündungen des Milchdrüsengewebes und werden durch Mikroorganismen verursacht. Die Entzündungsreaktionen des Milchdrüsengewebes dauern oft deutlich länger an als die verursachenden Infektionen, was ein wichtiger Grund dafür ist, warum nicht bei allen Euterentzündungen Mikroorganismen nachweisbar sind.
Bekämpfungskonzepte
Da eine gezielte Behandlung der Entzündung selbst kaum möglich ist, konzentriert sich die Therapie von Euterentzündungen vor allem auf die antibiotischen Bekämpfung der Infektionen. Euterentzündungen lassen sich am besten durch die Vermeidung von Infektionen vorbeugen. Da alle Mikroorganismen, die Mastitiden verursachen, unterschiedliche Ursprünge und Übertragungsmechanismen haben, sind dafür zahlreiche Massnahmen im Stall und beim Melken nötig. Dennoch lassen sich Infektionen nie ganz verhindern.
Übertragung der Erreger
Die Hygiene des Melkprozesses ist in vielen Betrieben mittlerweile so gut, dass zum Beispiel die Übertragung von Staphylococcus aureus beim Melken nur noch eine marginale Rolle spielt. Hingegen stellen die vielfältigen Rückzugsorte und Übertragungswege der sogenannten umweltassoziierten Erreger (Streptococcus [Sc.] uberis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia [E.] coli u.v.a.) Milchviehbetriebe vor neue Anforderungen. Diese Erreger verursachen vermehrt schwere Euterentzündungen und damit auch mehr Todesfälle bei Milchkühen. Trotz Behandlung verlassen in einem Zeitraum von 30 Tagen nach einem Mastitisfall 12,5 % der Tiere mit Sc.-uberis-Mastitiden den Betrieb. Bei Infektionen mit E. coli und Klebsiellen ist die Zahl der Todesfälle mit bis zu 75 % deutlich höher.
Die Sauberkeit des Zitzenendes ist entscheidend, um die Übertragung zu verhindern.
Während Sc. uberis auf der Weide, in strohbasierten Einstreusystemen und an allen Orten zu finden ist, die von Kühen häufig aufgesucht werden (Tränken, Warteräume vor dem Melken, Triebwege), sind Klebsiellen und E. coli im Kot der Tiere und in allen Einstreumaterialien, die nennenswert Lignin enthalten, nachweisbar.
Das macht deutlich, dass die Sauberkeit des Zitzenendes entscheidend ist, um die Übertragung dieser Mikroorganismen zu verhindern. Saubere und trockene Liegebereiche und Laufgänge sind hier massgebend. Um dies sicherzustellen, müssen mindestens 90 % der Kühe einer Milchviehherde saubere Euter und Zitzen aufweisen. Dies kann mithilfe von im Internet verfügbaren «Scorecards» (Bilder für jede Sauberkeitsstufe, siehe Kasten) in der eigenen Herde geprüft werden. Ob der Liegebereich trocken genug ist, kann durch Trocknung des oberflächlichen Boxenmaterials bestimmt werden (z. B. mit Heissluftfritteuse oder Dörrobsttrockner). Das oberflächliche Boxenmaterial sollte stets mehr als 70 % Trockenmasse aufweisen. Neben diesem Hauptinfektionsweg besitzen die genannten Mikroorganismen noch weitere Eigenschaften, die sie als Mastitiserreger gefährlich machen. Sc. uberis verändert das infizierte Drüsengewebe und ermöglicht es anderen Bakterien der gleichen Spezies, nach Abheilung die Milchdrüse erneut zu infizieren. Dies führt dazu, dass im Betrieb der Eindruck entsteht, die Erkrankung sei nach einer Behandlung nicht ausgeheilt, obwohl es sich um eine Neuinfektion handelt. Kurz nach einem Fall kommt es zu einem nächsten Fall mit einem anderen Erreger der gleichen Art.
Insbesondere in Phasen mit Hitzestress gelingt es einigen Sc.-uberis-Stämmen, sich in infizierten Milchdrüsen sehr stark zu vermehren. Dadurch werden viele Bakterien mit der Milch ausgeschieden und haften am Zitzengummi. Dies hat zur Folge, dass zum Beispiel im Sommer die Übertragung von Sc. uberis über das Melkzeug stattfinden kann. Deshalb ist im Sommer eine gute Melkhygiene besonders wichtig.
E. coli und Klebsiellen sind Teile der normalen Magen-Darm-Flora des Rindes. Mit ansteigendem Stärkegehalt im Futter nimmt die Zahl dieser Erreger im Verdauungstrakt der Kühe zu. Beide Mikroorganismen sind eigentlich nicht optimal an Milchdrüsen von Kühen angepasst, sodass sie oft erst dann an Bedeutung gewinnen, wenn zum Beispiel durch die Melkhygiene die Staphylokokken und andere Streptokokken zurückgehalten werden. Durch die zunehmende Nutzung von Pressgülle, Biogassubstrat, Kompost und Späne steigt das Risiko für solche Mastitiden – insbesondere für Klebsiellenmastitiden. Dabei sind vor allem diejenigen Materialien gefährlich, die eine Trockenmasse in der Liegebox von 70 % unterschreiten.
Wie schwer einzelne Tiere an einer Euterinfektion mit diesen Erregern erkranken, hängt von der Erregerart, aber vor allem vom Immunstatus der Kuh ab. Eine knappe Energieversorgung, Schwankungen der Trockensubstanzaufnahme oder ein Mangel an Selen oder Vitamin E können den Schweregrad der Erkrankung deutlich beeinflussen (leichte oder mittlere Mastitis vs. festliegende Kuh mit schwerer Mastitis).
Behandlung
Sc. uberis kann durch einfache lokale Behandlung mit Pencillin sehr erfolgreich aus der Milchdrüse entfernt werden. Allerdings schützt die erfolgreiche Therapie nicht vor einer unmittelbaren Neuinfektion mit einem anderen Bakterium. In der Trockenstehzeit heilen Infektionen mit Sc. uberis unter antibiotischer Therapie in mehr als 80 % aller Fälle aus.
E. coli kann in der Milchdrüse in den allermeisten Fällen nicht lange überleben. Deshalb ist die lokale Behandlung mit Antibiotika bei diesem Erreger wirkungslos.
Klebsiellen können etwas länger als E. coli in der Milchdrüse bleiben. Trotzdem ist auch hier die lokale antibiotische Behandlung nur wenig wirksam. Alle drei Mikroorganismenarten können aber bei schweren Mastitiden die Blut-Euter-Schranke so zerstören, dass sie in den Blutkreislauf des Tieres gelangen. In diesen Fällen besteht das Risiko der Entwicklung einer Sepsis und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Tiere sinkt. Deshalb ist es bei schweren Mastitiden richtig, Kühe mit einem breit wirksamen Antibiotikum (das alle drei genannten Arten abdeckt) über die Muskulatur oder das Blut zu behandeln. Zusätzlich sollten Tiere mit schweren Mastitiden mit Flüssigkeit versorgt werden (z. B. Drench) und einen Entzündungshemmer erhalten.
Im Sommer ist eine gute Melkhygiene besonders wichtig.
Die antibiotische Behandlung von Kühen in der Trockenstehzeit nimmt nur wenig Einfluss auf Infektionen mit E. coli und Klebsiellen. Durch die unhygienische Applikation von Eutertuben können zudem gerade zu Beginn der Galtzeit leicht Infektionen ausgelöst werden.
Infektionen verhindern
Sc. uberis, Klebsiellen und E. coli infizieren Milchdrüsen laktierender Milchkühe und können subklinische bis schwere klinische Mastitiden verursachen. Die Mikroorganismen stammen aus dem Umfeld der Tiere. Deshalb spielen stallhygienische Aspekte in der Verhinderung von Infektionen eine besondere Rolle («sauber und trocken»). Die Vorreinigung der Zitzen vor dem maschinellen Milchentzug kann die Keimdichte am Zitzenende geringhalten und so Infektionen verhindern. Kühe mit gleichmässiger Trockensubstanzaufnahme und guter Energieversorgung erkranken weniger schwer. Die Therapie von Infektionen kann nur dabei helfen, den Schaden des Einzeltieres zu begrenzen, aber nicht die Herde vor Infektionen schützen.