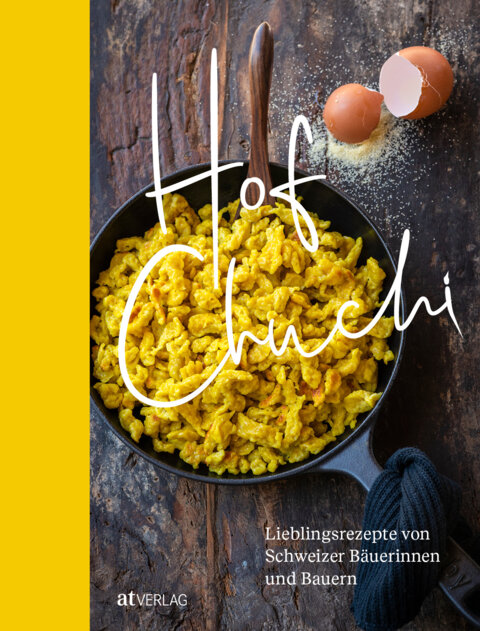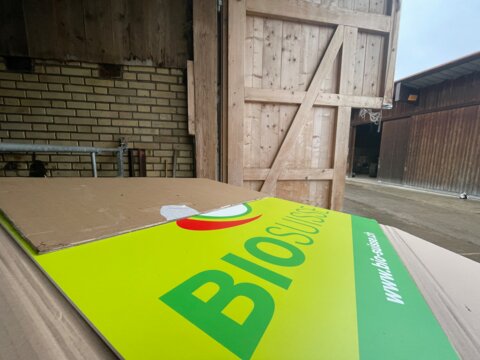Die Gülleseparation ist eine interessante Technik, um die Futterverschmutzung zu reduzieren und das Eindringen von Stickstoff in den Boden zu beschleunigen. Dennoch sollte sie nicht als einzige Option in Betracht gezogen werden, da sie teuer ist und bei der Separierung Verluste entstehen. Für die Entscheidungsfindung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Einerseits wirtschaftliche, wie die Möglichkeit, die Feststoffphase als Einstreu zu verwenden, andererseits auch praktische, wie das Risiko verstopfter Schläuche, der Verschleiss der Ausbringgeräte, technische Schwierigkeiten oder auch die Gefahr von Futterverunreinigungen. Anhand der nebenstehenden Behauptungen lässt sich der Nutzen der Gülleseparation für einen landwirtschaftlichen Betrieb ermessen.
Trennung ist die einzige Lösung, um Güllewürste beim Gülleaustrag zu vermeiden.
Falsch. Nach dem Trennen fliesst die Gülle tatsächlich besser und schneller auf den Boden und hinterlässt an den Blättern weniger faserige Rückstände. Dies ist somit eine Lösung, aber nicht die einzige.
Um Verschmutzungen zu minimieren, gibt es weitere Möglichkeiten: die Gülle möglichst nahe am Boden ausbringen, eine ausreichende Zerkleinerung des organischen Materials für den Schleppschlauch und die Gülleinjektoren gewährleisten, Ausbringmenge auf weniger als 25 m³/ha reduzieren, das Ausbringen kurz vor einsetzenden Regenfällen vornehmen, Gülle direkt auf den Boden ausbringen, Gülle verdünnen und für ausgewogene Futterrationen für die Tiere sorgen. Der Einsatz von Zusatzstoffen sowie die Belüftung oder das Aufrühren der Güllegrube spielen womöglich eine Rolle, doch derzeit ist diesbezüglich der Nutzen wissenschaftlich nicht belegt.
Wenn mit der Separation darauf abgezielt wird, die Gülle zu verflüssigen, sind in der Feststoffphase nicht mehr als 30 % Trockensubstanz (TS) notwendig. Zudem begünstigt etwas Flüssigkeit eine bessere Lagerfähigkeit.
Das Verdünnen von Gülle mit Wasser ist kostengünstiger als die Separation.
Falsch. Die Fliessfähigkeit von Gülle kann durch eine starke Verdünnung verbessert werden, beispielsweise auf weniger als 3,5 % TS. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Kosten für das Lagern und Ausbringen etwa anderthalbmal so hoch wie die Kosten für die Separation. Wenn die Lagerkapazität kein limitierender Faktor ist, ist die Verdünnung eine der Separation gleichwertige Lösung.
Die Kosten für Gülleseparierung sind hoch.
Richtig. Durchschnittlich betragen diese volumenabhängig drei bis vier Franken pro Kubikmeter Gülle. Hinzu kommen die Kosten für das Ausbringen der Güllefeststoffe. Für einen Betrieb mit 2500 m 3 Gülle, die zu separieren ist, übersteigen die Kosten den Wert der Milch von zwei Kühen.
Die Kosten können gesenkt werden, indem die für die Lagerung erforderlichen Volumen reduziert werden.
Falsch. Theoretisch reduziert die Gülleseparation das zu lagernde Volumen an flüssiger Gülle um 10 bis 15 %. In der Praxis kommt es selten zu einer Verringerung des Lagervolumens, insbesondere wenn die Trennung eine Umfüllgrube erfordert. Die Einsparungen entstehen vor allem aufgrund der um einige Tage verlängerten Lagerkapazität. Einige Betriebe trennen die Gülle, indem sie die Flüssigstoffphase wieder in die ursprüngliche Güllegrube einleiten. Die Trennung erfolgt somit, bis nicht mehr ausreichend Feststoffe entnommen werden können.
Trotz allem bringt dieser Prozess auch ökonomische Vorteile: Er verringert die Menge der auszubringenden Gülle und senkt die Rührkosten. Zudem kann der Weiterverkauf der Feststoffphase als «Mist» eine interessante Erwerbsquelle sein. Gewisse Vorzüge sind zwar schwer zu quantifizieren, könnten aber entscheidend sein für die Anschaffung eines Gülleseparators: sauberes Futter, eine geringere Geruchsbildung beim Ausbringen und weniger Probleme mit verstopften Schläuchen.
Pressschnecken sind die am häufigsten eingesetzten Gülleseparatoren.
Richtig. In der Schweiz findet man am häufigsten Press-schnecken-Separatoren. Zum Trennen von Fest- und Flüssigphase drückt eine Pressschnecke die Gülle in ein Sieb mit einer Maschenweite von einem halben Millimeter. Ein Stopfen am Ende der Presse verlangsamt den Austritt der Feststoffphase, wodurch der TS-Gehalt verändert werden kann.
Es gibt verschiedene Modelle von Separatoren von 5 bis 15 kW, die auf die Grösse eines jeweiligen Betriebs zugeschnitten sind, sowie leistungsstärkere Modelle für Lohnunternehmerinnen und -unternehmer. Die Schwächen der kleineren Modelle sollten jedoch nicht unterschätzt werden. Die Zentrifugalseparatoren sind bei einer trockeneren Feststoffphase effizienter, jedoch auch teurer und daher nicht sehr verbreitet. Bezüglich Sieb-Phasentrenner sind diese zwar kostengünstig, aber nicht sehr schnell. Ausserdem sind sie bezüglich Leistung limitiert und liefern nicht immer einen ausreichenden TS-Gehalt.
Die Separation von 500 m3 kann an einem Tag erfolgen.
Richtig und falsch. Eine durchschnittliche fest eingerichtete Pumpe fördert zwischen 15 und 30 m 3 Gülle pro Stunde: Sie eignet sich für Betriebe, die ihre Gülle jeden Tag aus einer Vorgrube separieren. Bei grösseren Mengen sollte man sich an ein Lohnunternehmen wenden.
Die bei der Abscheidung entstandene Feststoffphase kann als Einstreu für die Liegeboxen des Viehs verwendet werden.
Richtig und falsch. Grundsätzlich richtig, aber diese Nutzung hängt vom Milchabnehmer oder vom Label ab. Für den Gruyère AOP sowie in einigen Ländern (Deutschland) ist dies verboten. Selbst wenn es viele erfolgreiche Beispiele gibt, muss streng auf die Eutergesundheit und die Milchhygiene geachtet werden. Ziel ist, in den Liegeboxen eine Feststoffphase mit einem TS-Gehalt von etwa 35 % einzusetzen.
Wird diese Schwelle unterschritten, erhöhen sich die Gesundheitsrisiken. Liegt sie darüber, ist die Schicht weniger kompakt, was die Staubbildung begünstigt. Idealerweise sollte beim Zusammenpressen mit der Hand keine Flüssigkeit austreten und die entstandene Kugel bei nachlassendem Druck langsam wieder zerfallen. In Betrieben, in denen diese Einstreu zugelassen ist, ist der Nutzen gross, da der Kauf herkömmlicher Einstreu entfällt. Die dadurch erzielten Einsparungen decken beinahe vollständig die Kosten für die Gülleseparation.
Die Nährstoffgehalte der Gülle bleiben vor und nach der Separation unverändert.
Falsch. Im Durchschnitt befinden sich nach der Trennung die Hälfte der organischen Substanz, ein Viertel des Phosphors und ein Viertel des Gesamtstickstoffs in der festen Phase. Dessen muss man sich im Hinblick auf die Bodenfruchtbarkeit bewusst sein. Beim Kalium gibt es keine Veränderungen. Der Gehalt an Ammoniumstickstoff ist in der flüssigen Phase um bis zu 10 % höher als in der gesamten Gülle. Durch das schnellere Eindringen der flüssigen Phase der abgetrennten Gülle in den Boden ist eine effizientere und kurzfristigere Stickstoffwirkung zu erwarten.
Bis heute hat die Feststoffphase der separierten Gülle keinen besonderen Stellenwert und wird nach wie vor als Gülle betrachtet.
Die Ammoniakverluste sind geringer bei separierter Gülle.
Falsch. Beim Ausbringen entstehen weniger Verluste, da die Gülle rascher fliesst. Auf diese Weise können die NH3 -Verluste um 25 bis 75 % reduziert werden.
Das Problem liegt in den erhöhten NH3 -Verlusten während der Separation sowie der Lagerung der Güllefeststoffe. Es empfiehlt sich deshalb, die Feststoffphase abzudecken oder unverzüglich in den Boden zu bringen. Verluste können teilweise auch bei der Lagerung der flüssigen Phase aufgrund einer fehlenden Oberflächenkruste entstehen.
Die Wissenschaft ist sich einig, dass Trennung kein Mittel ist zur Begrenzung der Ammoniakverluste.