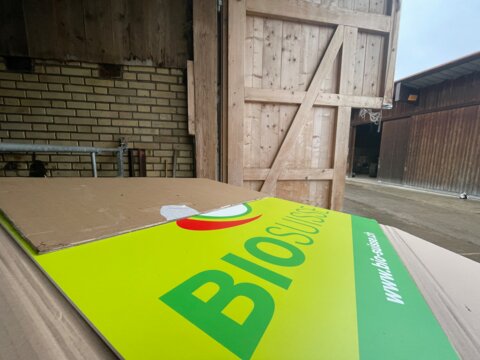Quer gelesen
– Genomeditierungstechnologien sind präziser als die Gentechnologie der 1990er-Jahre.
– Durch Stilllegen oder Modifizieren eines Genes können neue Nutzpflanzen gezüchtet werden, ohne artfremdes Genmaterial einzufügen.
– Das Gentechmoratorium lässt lediglich Grundlagenforschung zu. Die Debatte über die zukünftige Regelung ist jedoch in vollem Gange.
Was sind Gene und die DNA?
Die DNA könnte man als das Kochbuch des Lebens bezeichnen und die Gene (die Erbinformation) darin sind die Rezepte. Diese geben dem Lebewesen vor, wie sein Organismus etwas herstellen muss — sei es die Farbe einer Rose oder die Proteinzusammensetzung von Soja. In den Nachkommen zweier Pflanzen finden sich je 50 Prozent der elterlichen Gene. Welche das sind, entscheidet überwiegend der Zufall.
Was ist eine Genschere?
Entdeckt wurde die Genschere Crispr/Cas schon 1987 in Japan bei der Untersuchung von Bakterien. Erst in den 2000er-Jahren fanden Forschende heraus, dass sie Teil des Immunsystems von Bakterien ist. Mithilfe der Genschere erkennen diese nach einem Virenangriff deren DNA wieder und können sie bei einem erneuten Angriff gezielt zerstören. 2012 erforschten die französische Wissenschaftlerinnen Emmanuelle Charpentier und die Amerikanerin Jennifer Doudna, wie das System gezielt genutzt werden kann, um DNA präzise zu schneiden und zu verändern. 2020 erhielten sie den Chemie- Nobelpreis.
Welchen Nutzen kann die Genomeditierung der Landwirtschaft bringen?
Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden grösser. Das sich verändernde Klima mit starken Trockenperioden und wiederum starken Regenfällen verlangt den Anbauflächen viel ab. Neben den klimatischen Problemen ist der zunehmende Wegfall von Wirkstoffen gegen Insekten und Krankheiten (auch solche, die aufgrund des Klimas neu auftreten) ein Dilemma für den Pflanzenbau. Es werden immer weniger neue Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel entdeckt. Oft ist ihre Entwicklung so teuer, dass sie den Nutzen nicht aufwiegt. Eine Pflanze zu stärken, damit sie sich selbst hilft, ist nachhaltiger. Die Natur hat ihr bis zu einem gewissen Mass Möglichkeiten gegeben. Gegen Insektenfrass besitzen manche Pflanzen vermehrt Härchen auf der Oberfläche oder bilden sekundäre Pflanzenstoffe. Auch Nützlinge werden über den Geruch angelockt. Mit der Genomeditierung können Pflanzen so verändert werden, dass sie diese Fähigkeiten ausbilden. Bei Pilz- und Bakterienkrankheiten gibt es ebenfalls natürliche Abwehrmechanismen. So erkennt der Mehltaupilz bei alten Weizenlandrassen ein Weizenprotein nicht, das er zum Eindringen in die Pflanze benötigt. In der Forschung wurde diese Mutation aus der Natur durch die Genomeditierung in modernen Weizensorten eingebracht.
Mit konventioneller Züchtung wäre dies eventuell auch gelungen, doch dies dauert lange. Um eine neue Weizensorte zu züchten und auf den Markt zu bringen, braucht es 12 bis 15 Jahre. Und es werden noch andere, gegebenenfalls unerwünschte Eigenschaften mitvererbt. Die Genomeditierung spart hier Zeit, Geld und Flächen für jahrelange Tests. Auch der Genpool liesse sich mittels Genomeditierung für die Züchtung diverser gestalten. Die Technologie greift ausschliesslich auf arteigene Gene zurück und imitiert Prozesse, wie sie auch in der Natur vorkommen.
Was unterscheidet die Genomeditierung von früheren Gentechniken?
Die Gentechnik der 1990er-Jahre war unspezifisch und wenig gezielt. Sie setzte darauf, dass mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden konnten und die Nutzpflanze dies tolerierte. Es wurden neben arteigenen Genen (Cisgenen) auch artfremde (Transgene) eingesetzt. Dies unterscheidet sie von der Genomeditierung, bei der keine Artgrenzen übergangen werden. Die Genomeditierung ist nicht nur präziser, sondern auch günstiger als herkömmliche Gentechnologien. Das macht sie auch für kleine und mittlere Züchtungsunternehmen, die in Nischen tätig sind, eher anwendbar. Befürworterinnen und Befürworter erhoffen sich davon unter anderem mehr Sortenvielfalt und mehr Konkurrenz für die globalen Player, die heute den internationalen Saatgutmarkt dominieren. Sie sprechen sich darum für ein zweckmässiges und risikobasiertes Zulassungsverfahren aus, das diesen Kostenvorteil nicht zunichtemacht.
Was brachte die frühere Gentechnik der Landwirtschaft?
Zwei der bekanntesten Genprodukte auf Basis der herkömmlichen Gentechnologien sind transgener Bt-Mais und «Roundup Ready»-Soja. Beide besitzen Gene eines Bakteriums. Der Mais bildet ein Protein, welches nicht nur für die Maiszünsler- und Maiswurzelbohrer-Larven giftig ist, sondern wie sich herausstellte auch für einige Nützlinge und vermutlich für diverse Bodenorganismen. Zudem entstanden bei den Schadinsekten Resistenzen. Der wirtschaftliche Druck auf Betriebe in der Dritten Welt ist wegen des teuren Saatguts erheblich. Der Saatgutnachbau ist verboten und wird streng kontrolliert. In Deutschland, Österreich und Frankreich ist der Anbau verboten. Auch die Geschichte des «Roundup-Soja» ist zweischneidig. Er besitzt eine Resistenz gegen Glyphosat und stirbt so nicht ab, wenn das Herbizid auf den Bestand appliziert wird. Das bringt höhere Erträge und spart Arbeitszeit. Die Kehrseite: Die Anwendung von Glyphosat nahm deutlich zu – mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt. In der EU selbst wird kein genetisch verändertes Soja angebaut, aber importiert.
Gehört zur Genomeditierung nur die Genschere?
Nein, der Begriff Genomeditierung umfasst mehrere molekulare Methoden, mit denen das Genom gezielt verändert werden kann. Die bekannteste und laut Wissenschaft vielseitigste Methode ist aber die Genschere Crispr/Cas. Weitere Methoden sind Zinkfingernukleasen, Gene Drive, Talens und Meganukleasen. Neuere Methoden sind Base Editing und Prime Editing. Die beiden letzteren basieren auf dem System der Genschere und gelten als noch präziser.
Wo sind Grenzen und Risiken der Genomeditierung für die Landwirtschaft?
Um eine erfolgreiche Genomeditierung durchzuführen, müssen die Zielgene bekannt sein. Bei komplexeren Merkmalen, die von vielen Genen gesteuert werden (zum Beispiel der Ertrag), oder regulatorischen Netzwerken wird es schwieriger. Hinzu kommen epigenetische Effekte, also Gene, die durch die Umwelt beeinflusst werden. Trotz der beschleunigten Methode müssen die veränderten Pflanzen in verschiedenen Umwelten auf ihren Mehrwert getestet werden. Das ist nicht anders als bei der konventionellen Züchtung. Und eine gefundene Resistenz kann gebrochen werden, so wie es auch bisher möglich war. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, ist, ob sich genomeditierte Pflanzen in der Umwelt auskreuzen. Wenn genetisch und biologisch (Blütezeitpunkt, Pollenverfügbarkeit) kompatible Pflanzen in der Nähe sind, kreuzen sich genomeditierte Pflanzen – wie jede andere Pflanze auch – in der Umwelt aus. Kritikerinnen und Kritiker erachten dies als Risiko. Ebenso steht die Sorge im Raum, dass es ähnlich wie bei den alten Methoden zu Veränderungen an der falschen Stelle im Genom kommt, das nennt man Off-Target-Effekte. Neue Verbesserungen der Technik wie Prime Editing oder Base Editing reduzieren dieses Risiko. Zuletzt bleibt die ethische Frage. Eine Veränderung am Pflanzengenom über eine natürliche Selektion durch den Menschen über Jahrtausende wird anders bewertet als ein Eingriff im Labor.
Wie ist die Gesetzeslage zur Genomeditierung?
In der Schweiz unterliegen die Anwendungen der Crispr/Cas-Technologien derzeit dem Gentechnikgesetz, das 2004 im Zusammenhang mit den damals angewandten Methoden der Gentechnologie in Kraft trat. Seit 2005 besteht ein Moratorium, also ein Aufschub, für den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in der Landwirtschaft, das zuletzt bis Ende 2025 zum vierten Mal verlängert wurde. Parallel zur Verlängerung beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen Erlass vorzulegen, für eine risikobasierte Zulassungsregelung für Pflanzen, Pflanzenteile, Saatgut und andere pflanzliche Vermehrungsmaterialien, die mit neuen Züchtungsmethoden hergestellt wurden und denen kein artfremdes Erbmaterial eingesetzt wurde. Während eine öffentliche Debatte über den zukünftigen Einsatz von genomeditierten Nutzpflanzen läuft, wird weiter Grundlagenforschung betrieben. Im Februar 2024 genehmigte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) einen Feldversuch mit Crispr/Cas modifizierter Gerste auf geschütztem Gelände.
EU schlägt Erleichterungen vor
2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Organismen, die mittels neuer Techniken wie Crispr/Cas erzeugt werden, als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) einzustufen sind und somit den strengen EU-Gentechnikgesetzen unterliegen. Allerdings hat die EU-Kommission einen Reformvorschlag vorgelegt, der Erleichterungen für Pflanzen vorsieht, die mit neuen genomischen Techniken wie Crispr / Cas gezüchtet wurden.
Liberale Handhabung ausserhalb der EU
Die USA, China, Kanada, Brasilien und Australien verfolgen einen fallbezogenen Ansatz im Umgang mit genomeditierten Pflanzen. Solange nur genetisches Material verwendet wird, das aus kreuzbaren Arten stammt und damit keine artfremde DNA enthält, unterliegen diese Pflanzen in der Regel nicht den strengen Regularien der Gentechnik. Sie können somit ohne besondere Auflagen angebaut, geerntet und vermarktet werden. Eine Kennzeichnungspflicht besteht in solchen Fällen ebenfalls nicht.