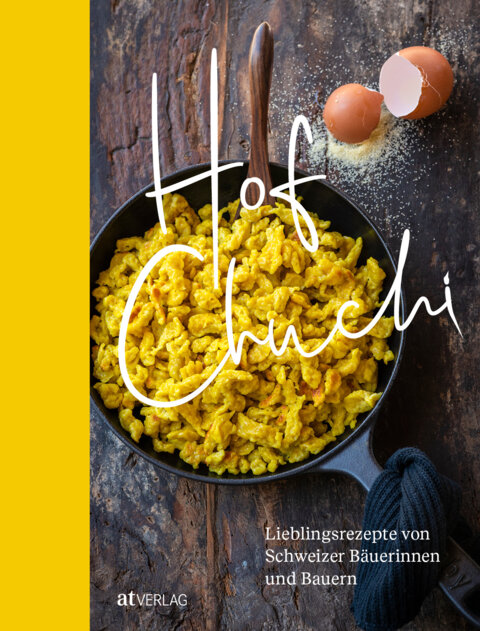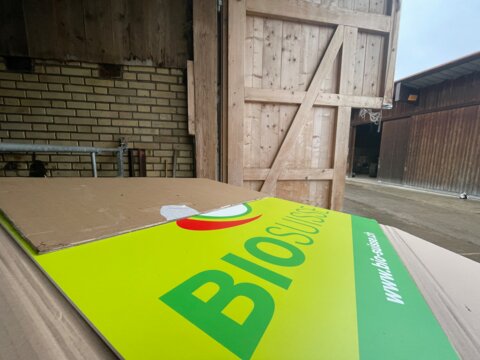Was mich immer fasziniert hat, ist die Präzision der DNA-Analysen, mit der selbst kleinste Details ans Licht gebracht werden können. Das durfte ich am eigenen Leib erfahren, als ich im Rahmen eines Kurses meine eigene DNA untersuchte. Wir sollten ein Gen via PCR-Methode nachweisen, das an der Bildung von Proteinen beteiligt ist – ein Gen, das in jedem Lebewesen vorkommt. Vor dem Test wurden wir angewiesen, nichts zu essen und den Mund auszuspülen. Mein Hunger war aber grösser, weshalb ich doch noch schnell ein paar Getreide-Cracker gegessen habe. Für den Test bekam jeder ein Röhrchen mit einer Flüssigkeit, mit der man den Mund ausspülen und dabei auf der Innenseite der Backen kauen sollte. Alle Kursteilnehmenden erhielten am Schluss einen Ausdruck mit einer schwarzen Linie als Nachweis des Gens – nur ich hatte zwei Linien. Die zweite Linie stammte von der DNA des Getreides, das ich kurz zuvor gegessen hatte.
Genanalysen arbeiten also sehr präzise, wenn das Ziel-Gen bekannt ist. Und genau dieses Wissen macht sich die Genom-Editierung zunutze, indem gezielt Veränderungen an bekannten Genen vorgenommen werden – Veränderungen, die theoretisch auch in der Natur durch Mutationen entstehen. Denn Mutationen sind gar nicht so selten. Eine Studie an der Acker-Schmalwand-Pflanze hat gezeigt, dass bei der Vererbung der elterlichen Genome auf die Nachkommen etwa zweimal pro Generation zufällige Mutationen auftreten. Zufallsprodukte bringen jedoch nicht zwangsläufig einen Vorteil – weder für die Pflanze selbst noch für die Landwirtschaft. Dies wäre der Unterschied beim Endprodukt der Genomeditierung. Diese ermöglicht gezielte Veränderungen im Erbgut von Pflanzen, um erwünschte Eigenschaften wie Krankheitsresistenz oder Ertragssteigerung zu fördern. Und das in einem Tempo, das mit natürlicher Auslese nicht möglich wäre. Natürlich macht man sich Gedanken, ob Fehler passieren könnten, gleichzeitig werden die Risiken aufgrund der Forschungsfortschritte zunehmend geringer. Wenn diese Technologie künftig auch ausserhalb der Forschung eingesetzt werden darf, hoffe ich stark, dass klare und vernünftige Richtlinien erarbeitet werden, die für Transparenz und Fairness sorgen.
Ich wünsche Ihnen eine informative und bereichernde Lektüre zum Thema Genomeditierung im Artikel "Die Genschere kompakt".