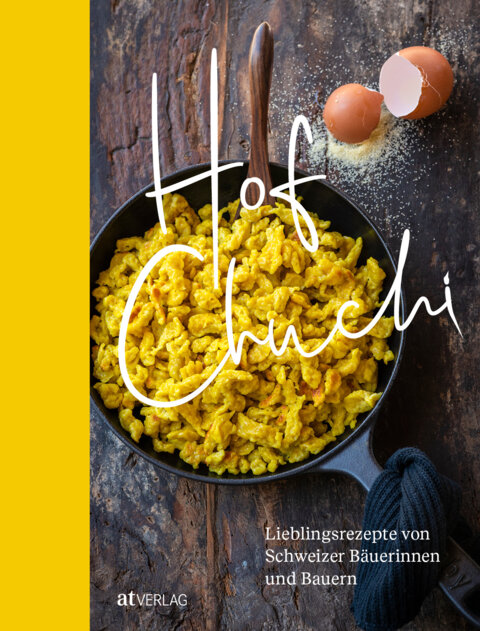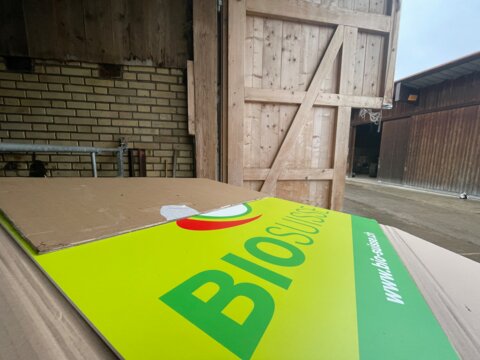Eine Ketose entsteht, wenn der Körper über einen längeren Zeitraum mehr Energie benötigt, als durch die Futterration zugeführt wird. Dies führt zu einer vermehrten Bildung von Ketonkörpern. Bei Schafen tritt die Krankheit vor allem im letzten Drittel der Trächtigkeit auf und wird daher Trächtigkeitstoxikose genannt. Die genaue Ursache ist unklar, aber das starke Wachstum der Föten in den letzten sechs Wochen der Trächtigkeit wird als Grund für den Energiemangel vermutet.
Bei Ziegen tritt die Stoffwechselerkrankung vor allem in der Startphase der Laktation auf, da dann der Energiebedarf durch die Milchbildung am höchsten ist. Untersuchungen zeigen, dass auch Schafe an Laktationsketose erkranken können – häufiger als bisher angenommen.
Beide Krankheitsformen verlaufen häufig «subklinisch», das bedeutet ohne sichtbare Symptome, aber mit erhöhten Ketonkörperwerten im Blut. Besonders gefährdet sind fette Tiere sowie solche mit schlechtem Allgemeinzustand oder hoher Parasitenbelastung.
Wie erkennt man eine Trächtigkeitstoxikose oder Laktationsketose?
Die Krankheit zeigt sich oft in erster Linie durch Appetitlosigkeit, gefolgt von einem Gewichtsverlust und bei der Laktationsketose zusätzlich durch verminderte Milchbildung. Diese Symptome sind unspezifisch und schwer zu erkennen.
Schwäche, Lethargie, neurologische Störungen wie Zittern oder Koordinationsprobleme und bei Trächtigkeitstoxikose Atembeschwerden treten meist erst auf, wenn es bereits zu spät ist. Es kann in der Folge sogar zu Fruchttod, Aborten oder im Extremfall zum Tod des Muttertieres führen.
Aufgrund der unspezifischen Symptome und des häufig subklinischen Verlaufs der Krankheit ist die sicherste Diagnose der Nachweis der erhöhten Konzentration von Ketonkörpern im Blut. Dabei haben sich Handmessgeräte aus der Humanmedizin bewährt.
Um eine Trächtigkeitstoxikose oder Ketose vorzubeugen oder frühzeitig zu erkennen, sollten die Tiere genau beobachtet und ihre Körperkondition überwacht werden. Dabei ist es wichtig, Über- oder Untergewicht bei trächtigen Schafen und Ziegen zu vermeiden. Die Körperkondition lässt sich einfach mit dem Body Condition Score (BCS) bestimmen. Vor der Geburt sollte der BCS idealerweise nicht über 3,5 liegen.
Um einen Leistungsabfall zu erkennen, ist es hilfreich, die Milchleistung der Tiere zu überwachen. Auch ein Appetitverlust kann bei einer guten Tierbeobachtung unter Umständen frühzeitig erkannt werden. Zudem sollten Stresssituationen vermieden werden, die den Energiebedarf erhöhen können.
Wird eine Trächtigkeitstoxikose oder Laktationsketose festgestellt, sollte zuerst die Energiezufuhr erhöht werden. Dazu können energiereiche Futtermittel verabreicht werden, wobei das Risiko einer Pansenazidose berücksichtigt werden muss. Die orale Verabreichung von Propylenglykol kann schnelle Abhilfe schaffen, alternativ kann der Tierarzt eine Glukoseinfusion veranlassen.